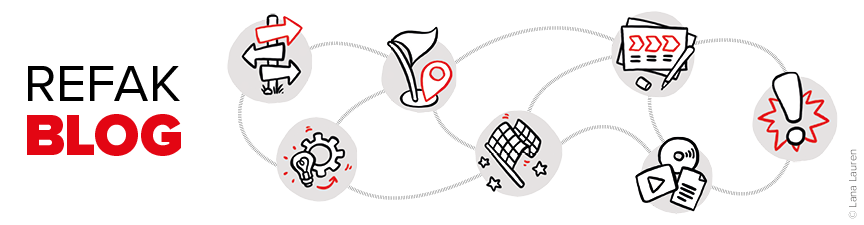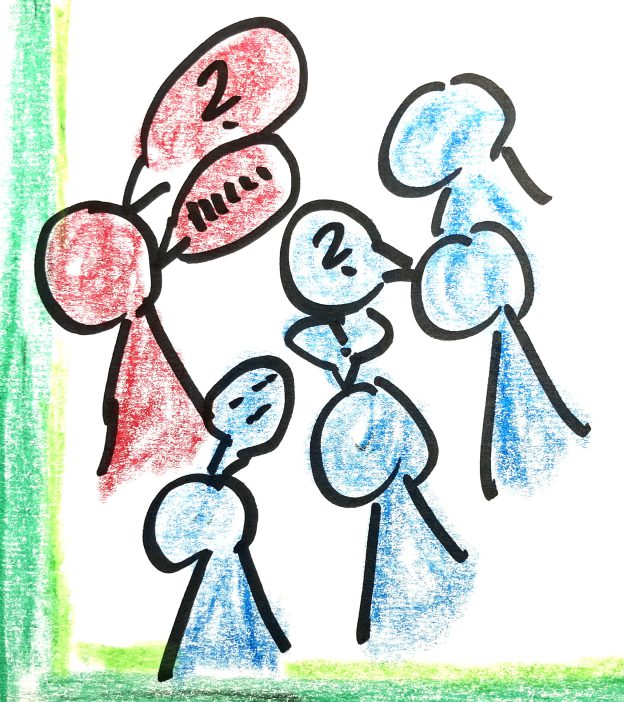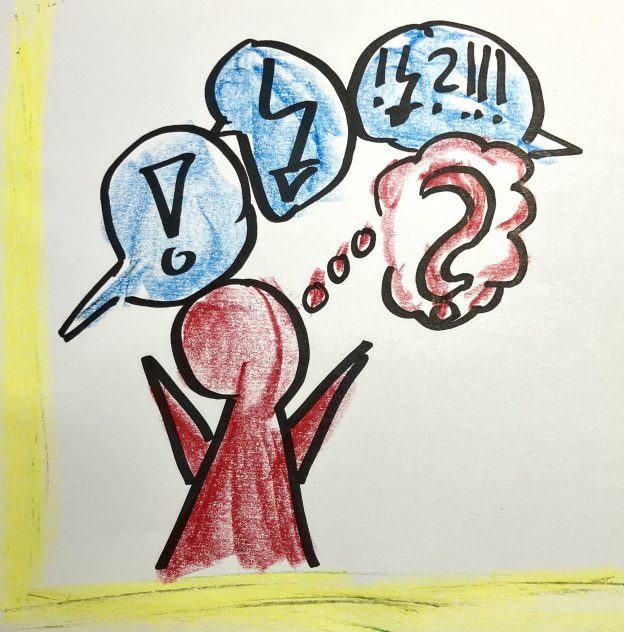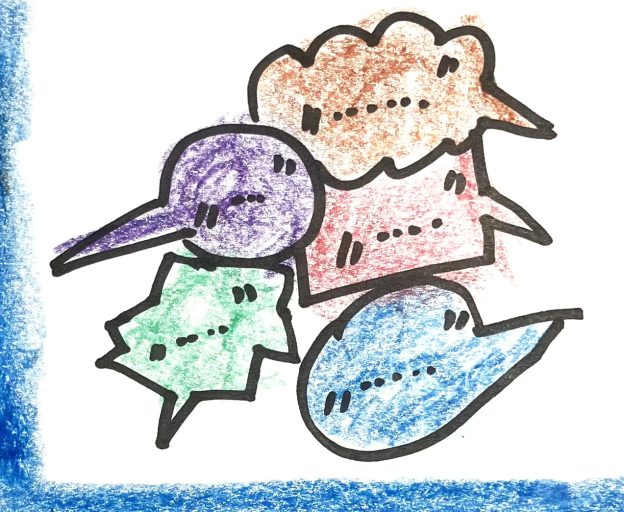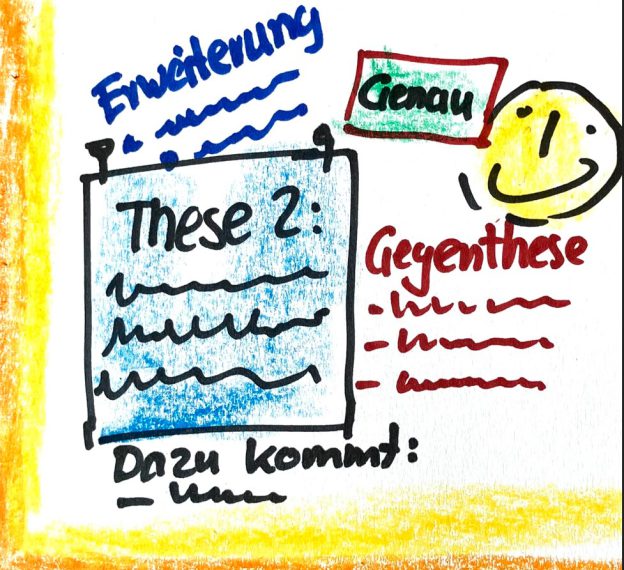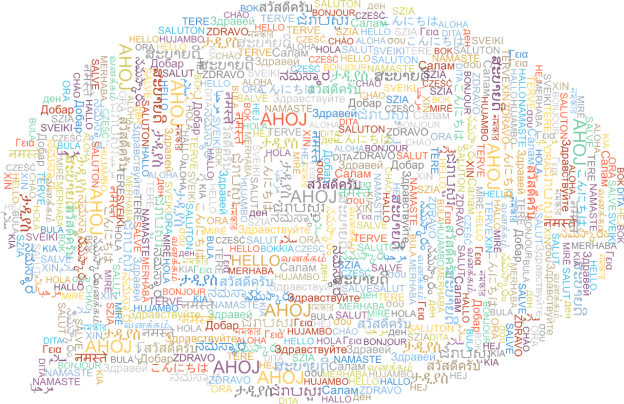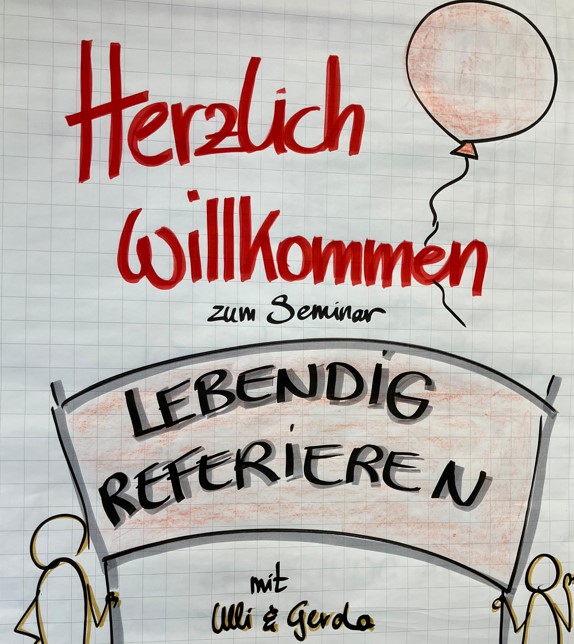
Ein Crashkurs für das Weitergeben von Wissen und Erfahrung
Auch in Auflage 3 dieses Seminars vom 7. bis 9. April 2025 saß eine sehr bunte Gruppe im Seminarraum in Wien. Gerda Kolb als Gruppendynamik-Expertin und „Methodenfuzzy“ Ulli Lipp führten durch die Tage. In dieser Dokumentation gibt es Tipps und Tools auch für Kolleg:innen, die nicht dabei waren. Details zu den Methoden und Tools findet ihr verlinkt.
Weiterlesen