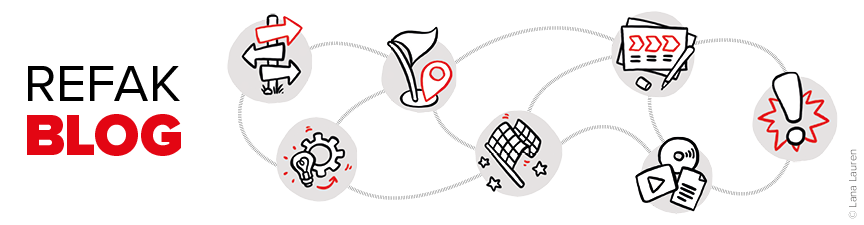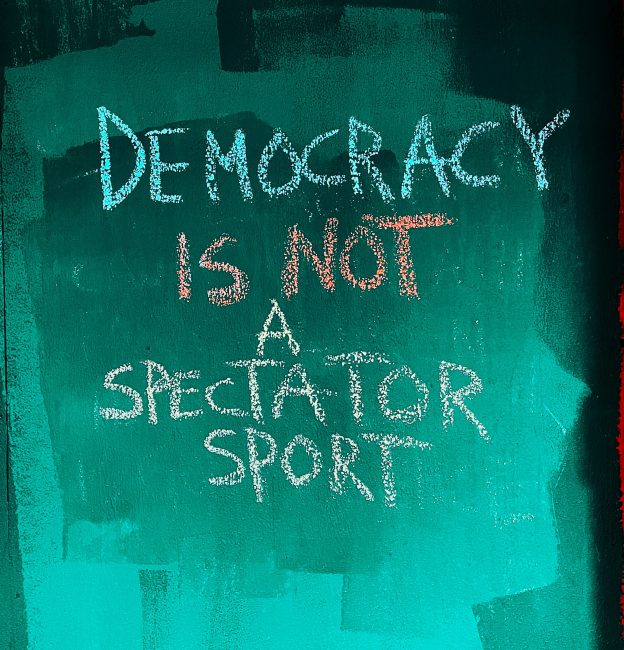
Demokratiekompetenz ist mehr als ein theoretisches Konzept – sie ist gelebte Praxis, also kein „Zuschauer:innensport“. Besonders in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung kann sie aktiv gefördert werden. Demokratie entsteht dort, wo Teilnehmende die Erfahrung machen, selbst wirksam zu sein und mitzugestalten.
Im letzten #dimi_26-Beitrag ging es um die Frage, was unter Demokratiekompetenz zu verstehen ist. Diesmal stelle ich Lernressourcen und Methoden vor, die dazu beitragen können, dass Demokratiekompetenz im Seminarraum wirklich erlebbar wird.
Kritisches Denken fördern
Kritisches Denken bezeichnet die Fähigkeit Informationen zu bewerten und zu interpretieren. Es geht also darum, Informationen nicht bedingungslos als wahr zu akzeptieren, sondern sie kritisch zu hinterfragen. Die Untersuchung der Quellen, wie dies beispielsweise bei Medientrainings geübt wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.
Im Seminar und als Trainer:innen der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung müssen wir jedoch eine andere, ebenfalls sehr wesentliche Dimension mit in Betracht ziehen: die soziale.

- Wessen Stimme wird im Seminar gehört?
- Wer wirkt als Meinungsbildner:in und welche Dynamiken entwickeln sich daraus in der Gruppe?
- Unterstützen wir als Trainer:innen Personen, die eine konträre Meinung vertreten und sorgen dafür, dass diese auch angehört wird oder übergehen wir solche Momente schnell, bevor es zu einer unangenehmen Diskussion kommt?
Mehr zum Thema Diversität und dem Schaffen einer inklusiven Lernkultur, in der jede und jeder darauf zählen kann, gehört zu werden, beschreibe ich im #dimi_09.
Viele Methoden, die in der gewerkschaftlichen Bildung regelmäßig eingesetzt werden, fördern – bei richtiger Anwendung – das kritische Denken. Dazu gehören Formate wie Rollenspiele. Dabei nehmen die Lernenden durch das Einnehmen einer spezifischen Rolle (des/der Geschäftsführer:in, des/der Betriebsratsvorsitzenden etc.) automatisch verschiedene Perspektiven ein und entwickeln aus dieser Position Argumente, mit denen sie andere überzeugen können. Ganz im Sinne des erfahrungsorientierten Lernens.
Der Lerneffekt solcher Übungen steht und fällt mit einer gut angeleiteten Reflexionsschleife, in der das Erlebte analysiert und eventuell mit theoretischen Modellen verknüpft wird. Erst dann wird aus der Lernerfahrung Handlungskompetenz.
Selbstgesteuertes und beteiligungsorientiertes Lernen

In der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit sollen die Teilnehmenden nicht nur Konsument:innen von Bildung sein, sondern den Bildungsprozess stets auch selbst mitgestalten. Ziel ist es, dass Demokratie und Beteiligung für die Teilnehmenden erlebbar werden und sie ihre Selbstwirksamkeit erleben können.
Ein methodischer Ansatz, der diesen Prozess unterstützt, ist das „problembasierte oder problemorientierte Lernen“.
Dabei wählen die Trainer:innen im Vorfeld geeignete (und durchaus umfassende) „Fallszenarien“ aus, die von den Teilnehmenden selbstorganisiert bearbeitet werden. Diese Vorgangsweise fördert sowohl die Selbstlernkompetenz als auch das kritische Denken. Die Teilnehmenden lernen, Informationen zu recherchieren, diese zu hinterfragen und eigene Positionen zu entwickeln, die sie abschließend begründen und verteidigen. Eine ausführliche Beschreibung des Ablaufs, der Rolle der Trainer:innen, sowie der Nutzung digitaler Tools findet man hier.
Meinungen vertreten und andere Meinungen anhören
Nicht zuletzt leben demokratische Prozesse von der konstruktiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und dem Entwickeln einer guten Streitkultur. Die dafür notwendigen Fähigkeiten können in der gewerkschaftlichen Bildung wunderbar geübt und gestärkt werden. Im Rahmen von Argumentationstrainings werden diese Kompetenzen beispielsweise ganz gezielt geübt.
Im Referenzrahmen für Kompetenzen für eine demokratische Kultur, den ich im #dimi_26 näher beschrieben habe, werden jedoch auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Zuhörens und Beobachtens, sowie Empathie und Anpassungsfähigkeit betont.

Diskussionen sind häufig eine Abfolge von parallelen Monologen, in denen jede Person ihre Positionen verteidigt, anstatt sich mit der Meinung des Gegenübers ernsthaft auseinanderzusetzen. In einem Dialog hingegen üben wir die Fähigkeit, andere Meinungen als gleichwertig anzuerkennen. Dabei geht es nicht darum, diese zu übernehmen, sondern anzuerkennen, dass die Meinung des Gegenübers eine Logik hat. Durch echtes Zuhören kann ich diese erkennen, was auch häufig dazu führt, dass die andere Meinung weniger bedrohlich erscheint.
Konkrete Übungsmöglichkeiten bieten Methoden, in denen kontroverse Themen in einem sicheren und strukturierten Format besprochen werden können, eventuell auch mit einer zusätzlichen Beobachterin oder einem zusätzlichen Beobachter. Hier eine Beschreibung zur Methode: Kontrollierter Dialog
In dieser dialogischen Form des Austausches ist die Technik des Spiegelns besonders hilfreich. Dabei gibt die zuhörende Person das Gesagte möglichst wortgetreu wieder. Dies führt automatisch zu präziserem Zuhören. Wenn das Gesagte wiederholt wird, fühlt sich das Gegenüber gehört und kann es bei Bedarf präzisieren. Allein durch diese Verlangsamung ändert sich die Dynamik des Gesprächs und es entsteht eine Zugewandtheit, die mehr Respekt und Empathie zulässt.
Fazit ist: Demokratiekompetenz lässt sich nicht einfach „lehren“ – sie entsteht durch Erfahrung.
- Kritisch denken,
- selbstgesteuert lernen und
- Dialog führen
sind drei zentrale Wege, wie wir in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit Demokratiekompetenz fördern können. Jede Übung, die die Teilnehmende darin stärkt, macht Demokratie nicht nur zum Thema, sondern zur gelebten Praxis – im Seminarraum und darüber hinaus.
Zum Weiterlesen:
- Doppelbauer, Tobias, and Dirk Lange. 2025. Demokratie bilden! Was jede:r von uns tun kann! Verlag Anton Pustet Salzburg
- Methodisch-didaktisches auf der Website des Demokratiezentrum Wien
- Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung
Genannte (und auch andere) Bücher können HIER im Webshop des ÖGB-Verlags versandkostenfrei bestellt werden.
Autorin: Margret Steixner
Lust auf mehr? Zu allen Beiträgen der Serie kommst du HIER!

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich Lizenz.
Volltext der Lizenz