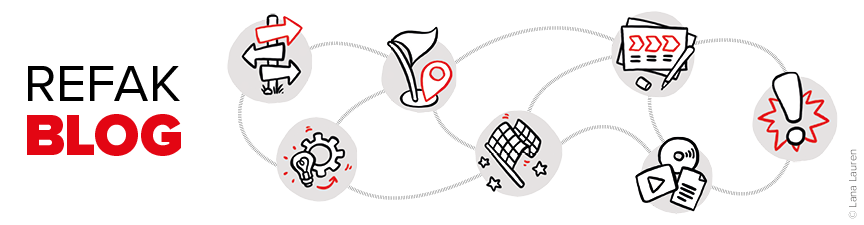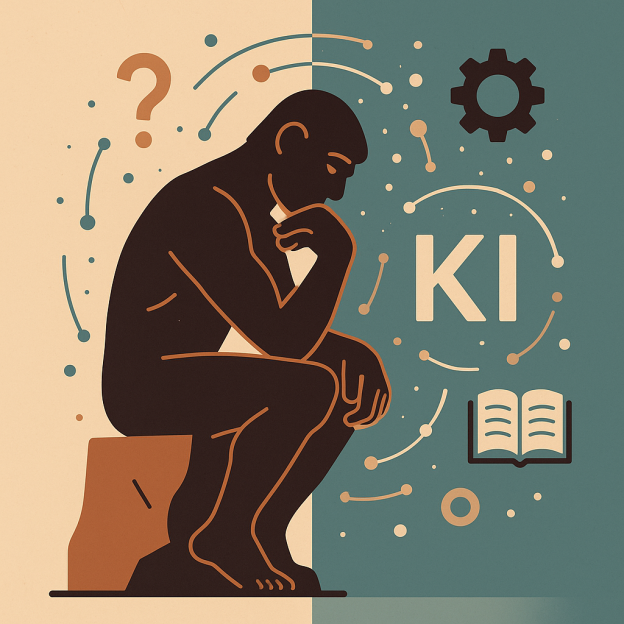
KI liefert verblüffend schnell Antworten. Eine E-Mail schreiben, eine Zusammenfassung erstellen, eine Recherche abgeben – alles in Sekunden. Doch was macht das mit uns? Werden wir dadurch denkfaul, vielleicht sogar dümmer? Aktuelle Studien legen das nahe: Häufige und unreflektierte Nutzung von KI-Modellen schwächt nachweislich das kritische Denken. Es geht aber auch anders. Wir können KI bewusst so einsetzen, dass sie unser Denken anregt und Argumentieren trainiert. In diesem Beitrag zeigen wir 5 Wege, wie das im Seminaralltag gelingt.
Was die Forschung zeigt
Eine Studie der Swiss Business School (Gerlich, 2025) mit mehr als 600 Erwachsenen zeigt: Je häufiger wir KI nutzen, desto schwächer schneiden wir in Tests zum kritischen Denken ab. Als Hauptgrund nennen die Forschenden Cognitive Offloading, also das Auslagern von Denkarbeit an Hilfsmittel (hier: KI). Besonders jüngere Nutzer:innen (17–25 Jahre), die im Alltag stark auf Chatbots setzen, zeigen deutlich geringere Analyse- und Urteilsfähigkeit. Personen mit höherem Bildungsniveau erzielen bessere Ergebnisse.
Noch konkreter zeigt das eine Untersuchung des MIT Media Lab (Kosmyna et al., 2025). 54 Studierende schrieben Essays – mit ChatGPT oder mit Google-Suche oder ohne Hilfsmittel. Währenddessen wurde ihre Gehirnaktivität per EEG gemessen. Das Ergebnis ist deutlich: Die Gruppe ohne Hilfsmittel zeigt die stärkste kognitive Aktivierung, die Suchmaschinen-Gruppe liegt im Mittelfeld, und ChatGPT-Nutzende weisen die geringste Aktivierung auf.
Auch qualitativ schneidet die KI-Gruppe schlechter ab: Ihre Aufsätze sind flacher, weniger differenziert, und viele erinnern sich kaum an das, was sie geschrieben haben. Das deutet darauf hin: Wenn wir Denkarbeit an KI auslagern, verarbeiten wir Inhalte weniger tief, erinnern schlechter und lernen weniger.
Kritisches Denken und Argumentieren aktiv üben
Wie können wir nun KI so nutzen, dass sie kritisches Denken und Argumentationsfähigkeit stärkt? Gerade in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, die das Ziel hat, reflektierte und mündige Teilnehmer:innen zu fördern? Hier sind 5 Ideen:
1. Rollenspiel: Argumentationstraining mit KI
In einem Rollenspiel mit KI können wir unsere Argumente prüfen und uns auf echte Dikussionen vorbereiten, zum Beispiel vor Verhandlungen oder schwierigen Gesprächen. Noch lebendiger wird diese Übung mit dem Audio-Modus eines KI-Modells (mit dem Modell sprechen statt in den Chat zu schreiben).
Möglicher Ablauf:
- Kontroverses Thema oder These wählen, zum Beispiel: „Handys sollten im Unterricht verboten sein.“
- Rollen verteilen: Eine Person oder Gruppe argumentiert Pro. Das KI-Modell übernimmt Contra (oder umgekehrt).
- Debatte mit KI führen:
Die KI liefert ein Argument mit Begründung und Quelle. Wir antworten mit einem Gegenargument, prüfen Belege und haken nach. Die KI reagiert, identifiziert Schwachstellen, hinterfragt Annahmen und kontert. Drei bis vier Runden reichen. - Reflexion:
Welche Argumente waren stark und warum? Wo hat die KI daneben gelegen oder „halluziniert“? Welche Einwände waren schwach begründet und warum?
Auf diese Weise lässt sich prüfen, wie stichhaltig eine eigene Position tatsächlich ist. Die KI „bohrt Löcher“ in scheinbar sichere Argumentationen, bevor es reale Diskussionspartner:innen tun. So entsteht ein geschützter Raum, in dem wir lernen, Gegenargumente zu entkräften oder eigene Überzeugungen zu überdenken.
⚙️ Beispiel-Prompt für Debatten-Rollenspiel
„Du bist eine sachliche, rhetorisch versierte Debatten-KI. Das Thema lautet: [THEMA]. Deine Position ist [PRO oder CONTRA]. Formuliere in der ersten Runde ein starkes Argument mit Begründung und Quellenangabe. Wenn ich Gegenargumente bringe, reagiere sachlich. Liefere eine Replik, hinterfrage meine Annahmen und weise auf Schwächen hin. Zeige eigene Zweifel oder alternative Sichtweisen, wenn das sinnvoll ist.“
2. Perspektivenwechsel
Wir können einen KI-Chatbot auffordern, als bestimmte Person oder Expertin zu antworten: „Was würde [eine bestimmte bekannte Person oder Expertin] zu diesem Vorschlag sagen?“ Oder wir nutzen etablierte Methoden wie die „Denkhüte“, indem wir die KI auffordern, nacheinander eine rationale, optimistische, kritische, kreative oder emotionale Perspektive einzunehmen.
Solche gezielten Perspektivwechsel fördern mehrdimensionales Denken: Argumente verändern sich je nach Standpunkt, und Lernende erkennen, wie Wahrnehmung und Begründung voneinander abhängen.
3. Sokratischer Dialog mit KI
Anstatt die KI nur als Antwortmaschine zu nutzen, kann sie unser Denken durch gezielte Fragen anregen. Ein einfacher Prompt könnte sein: „Stelle mir Schritt für Schritt Fragen, damit ich die Lösung selbst finde. Prüfe meine Antworten kritisch.“
Dieser Ansatz greift die Idee des Sokratischen Dialogs auf: Durch gezieltes Fragen und Nachhaken wird der Denkprozess selbst zum Lerngegenstand.
4. Fakten überprüfen und Quellenarbeit trainieren
Oft zeigt sich: Ein Sprachmodell nennt Quellen, die glaubwürdig klingen, aber gar nicht existieren. Diese „Halluzinationen“ bieten einen idealen Anlass, über die Funktionsweise von KI zu sprechen und zu verdeutlichen, dass Ergebnisse nie ungeprüft übernommen werden dürfen. Wir können außerdem gezielt danach suchen, wo in einer KI-Antwort Widersprüche oder Unstimmigkeiten auftauchen. Daraus können wir eine Lernaufgabe machen:
Beispielsweise können wir die KI auffordern, zu einer Behauptung Belege zu nennen, und anschließend gemeinsam prüfen, ob diese Belege real und belastbar sind.
⚙️ Beispiel-Prompt zum Faktencheck:
„Du bist mein Assistent für Faktenchecks. Deine Aufgabe ist es, jede von mir vorgegebene Information zu prüfen. Antworte immer in folgender Struktur:
1. Echtheit: Ist die Information nachweislich korrekt? (Ja/Nein/Unklar)
2. Deckungsgleichheit: Entspricht die Information zu 100 % dem Originalwortlaut/-wert? (Ja/Nein; falls Nein: kurze Abweichung nennen)
3. Quellen: Nenne nur überprüfbare, seriöse Quellen (z. B. offizielle Datenbanken, Regierungsseiten, renommierte Medien, wissenschaftliche Publikationen) und gib den Link an.
4. Unsicherheit: Wenn keine verlässlichen Quellen auffindbar sind, kennzeichne dies klar und liefere keine Spekulationen.
Arbeite faktenorientiert und vermeide Halluzinationen. Hier die Aussage zum Überprüfen: [AUSSAGE].“
Quelle: Patrick Große (adaptiert)
5. Bewusstes Prompting und Grenzen kennen
Beim Arbeiten mit KI lohnt sich immer die Frage: Lenkt mein Prompt kritisches Denken an oder macht es mich bequem? Förderlich sind Prompts, die Analyse, Vergleich und Begründung fordern, etwa „Beantworte die Frage und nenne mindestens zwei unterschiedliche Argumentationslinien sowie mögliche Gegenargumente.“
Hilfreich ist auch, die KI aufzufordern, „laut zu denken“ und Zwischenschritte offenzulegen: „Erkläre Schritt für Schritt, wie du zu dieser Schlussfolgerung kommst, und zeige deine Annahmen.“ So wird der Denkprozess nachvollziehbar und kritisierbar.
Wichtig: KI hat kein echtes Verständnis oder moralisches Urteilsvermögen. Diese Erkenntnis selbst ist Teil kritischer Reflexion und kann in der Erwachsenenbildung offen thematisiert werden.
Checkliste: Kritisches Denken mit KI
- Haben wir vor dem Prompten selbst gedacht?
- Stellt die KI Fragen oder liefert sie nur Antworten?
- Sind Quellen, Belege und Argumente nachvollziehbar?
- Habe ich nur meine eigenen Annahmen bestätigt oder gezielt andere Perspektiven und Argumente berücksichtigt?
- Hat die KI ihre Denkschritte erklärt?
- Haben wir Ergebnisse gemeinsam geprüft und reflektiert?
💬 Welche Erfahrungen machst du mit KI? Fördert sie deine Neugierde oder macht sie träge? Teile gerne deine Beobachtungen mit uns in den Kommentaren.
Autorin: Irene Steindl
Lust auf mehr? Zu allen Beiträgen der Serie kommst du HIER!

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich Lizenz.
Volltext der Lizenz