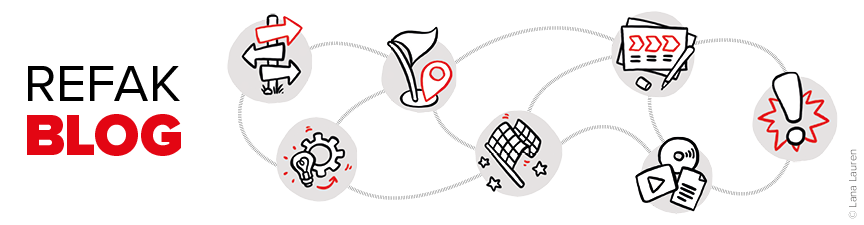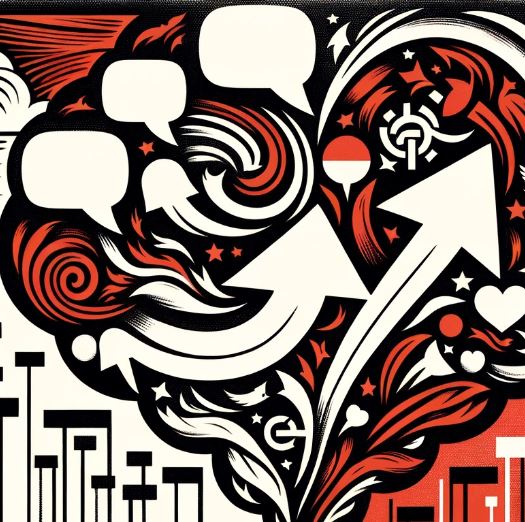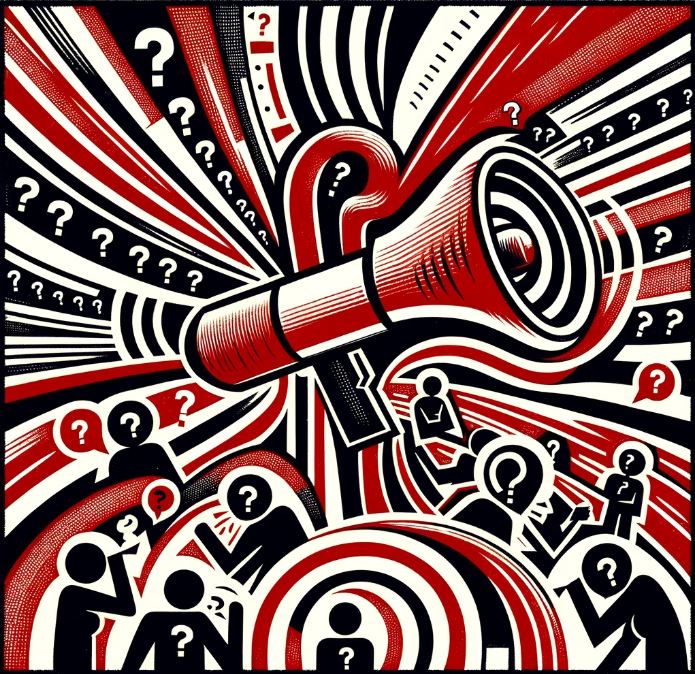Heinz-Christian Strache kennt spätestens seit dem Ibiza-Video 2019 jede Person. Er war Vizekanzler der Republik und lange Jahre Parteiobmann der FPÖ. Heinz-Christian Strache wächst in einfachen Verhältnissen in Wien auf…
Seine Familie stammt aus dem Sudetenland. Straches Vater verlässt die Familie, als er drei Jahre alt war, die Mutter ist für Heinz Christian Strache allein verantwortlich. Im Internat tritt er einer schlagenden deutschnationalen Burschenschaft bei und gerät so in jene rechtsextreme bzw. rechtspopulistische Kreise, die sein Leben in den nächsten Jahren prägen werden. Norbert Burger, ein rechtsextremer Politiker, der wegen der Involvierung in Sprengstoffattentate in Italien zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wird, nennt Strache bis heute seine „Vaterfigur“. Der bekannte Neo-Nazi Gottfried Küssel ist bei einer seiner berühmt gewordenen „Wehrsportübungen“ anwesend.
Ähnliche Geschichten lassen sich in Kindheit und Jugend von vielen Politiker*innen finden, die heute an der Spitze von rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien stehen. Einige Autor:innen vermuten überhaupt in der Art der Sozialisation einen Hauptgrund für die Ausbildung eines Hangs zu autoritärer oder populistischer Politik. Aber bei Weitem nicht alle Menschen, die ohne beide Elternteile aufwachsen oder Brüche in ihrer Biografie erleben, werden populistische oder extremistische Politiker:innen oder stimmen für diese. Die Gründe, warum Menschen solche Parteien wählen oder mit ihnen sympathisieren, sind vielschichtig.
Auf Wortsuche: Rechtspopulismus oder Linksextremismus
Zunächst stellt sich auch die Frage nach den richtigen Wörtern. Die Begriffe Populismus und Extremismus sind spätestens seit der ersten Amtszeit von Donald Trump in aller Munde, aber eine einheitliche Definition gibt es nicht. Der österreichische Verfassungsschutz (heute DSN) versteht unter Extremismus verschiedene Bestrebungen, die sich offen gegen den Staat wenden und dabei auch vor der Anwendung von Gewalt nicht zurückschrecken. Aus pädagogischer Perspektive scheint es mir sinnvoller, von verschiedenen Haltungen oder Ideologien zu sprechen, die sich durch Demokratieskepsis oder Demokratiefeindlichkeit auszeichnen. Aufgabe im Sinne der Politischen Bildung ist es ja, demokratische Grundwerte zu stärken. Dann erübrigt sich auch die Frage, wann wir von Linksextremismus bzw. Linkspopulismus oder Rechtsextremismus bzw. Rechtspopulismus sprechen. Die grundsätzliche Frage kann einfach lauten:
Sind bestimmte Ideologien, Haltungen oder auch Parteien und Vereinigungen für die Demokratie in Österreich problematisch oder nicht?
Auf Motivsuche: Die Einen gegen die Anderen
Bevor man sich die Frage stellt, was man pädagogisch tun kann, um gegen solche demokratiefeindlichen Werthaltungen aktiv zu werden, ist auch noch unbeantwortet, warum verschiedene demokratiefeindliche Ideologien für Menschen überhaupt attraktiv sind. Ein zentrales Motiv von allen demokratiefeindlichen Werthaltungen ist ein Verständnis von Politik, das sich auf ein „Wir gegen die Anderen“ herunterbrechen lässt. Politik ist eine Art Endkampf von Gut gegen Böse in einer schlechten Welt mit schlechten Menschen. Die Anhänger einer eigentlich demokratiefeindlichen Partei sind in dieser Welt die vermeintlich Guten.
Politik wird durch dieses Bild nicht nur grob vereinfacht, sondern es wird eine Gruppe gefunden („die Anderen“), die man entmenschlicht (= „Kriminelle“, „Staatsfeinde“, „Horden“, „Flut“, „Tiere“ etc.) und der man – zumindest verbal – mit Gewalt droht.
Attraktivitätsmomente für Anhänger:innen von Demokratiefeindlichkeit sind in der Regel die schon genannte Vereinfachung von komplexen Zusammenhängen, das Versprechen von schnellen Lösungen und auch das direkte Ansprechen von Ängsten und von Wut, die manche Bürger:innen berechtigterweise empfinden.
Frieden und Lösungssuche statt Eskalation
Eines der Hauptprobleme bei demokratiefeindlichen Bewegungen ist, dass diese zwar sehr gut darin sind, Ängste zu thematisieren und Anhänger:innen den Himmel auf Erden zu versprechen, diese Versprechen aber nicht einlösen können. Demokratiefeindlichkeit lebt von Ängsten, von Verunsicherung, von Eskalation, von der Entmenschlichung und von Willkür. Wer zum guten „Wir“ und wer zu den entmenschlichten „Anderen“ gehört, ist erstens frei erfunden und kann sich zweitens jederzeit ändern.
Demokratie hingegen verspricht keine einfachen Lösungen und ist anstrengend. In einer Demokratie werden unterschiedliche Menschen und Gruppen bei Entscheidungen mit all ihren Meinungen beteiligt, sie müssen aufeinander zugehen und Kompromisse schließen. Dabei wird auch berücksichtigt, dass wir Menschen mit eigenen Bedürfnissen und veränderbaren Meinungen sind und es auch menschlich ist, Fehler zu machen. Wir gehören nämlich manchmal zu „den Einen“ und manchmal zu „den Anderen“ – und das Schöne dabei ist: Das ist in einer Demokratie kein Problem.
Autor: Patrick Danter von Sapere Aude
Am nächsten demokratischen Montag…
… verfolgen wir die Spuren von Fake News, wie und wo sie entstehen und wie sie demokratische Prozesse beeinflussen können.
Quellen:
- Heinz Christian Strache (News)
- Heinz-Christian Strache: „Drei Bier“ und Paintball, das war einmal (Der Standard)
- HC Strache: Der Prater und der Strizzi (Die Presse)
- Heinz-Christian Strache: Charakter und Lebensweg einer tragischen Figur (Profil)
- Verfassungsschutzbericht 2022
Lust auf mehr? Zu allen Beiträgen der Serie kommst du HIER!

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich Lizenz.
Volltext der Lizenz